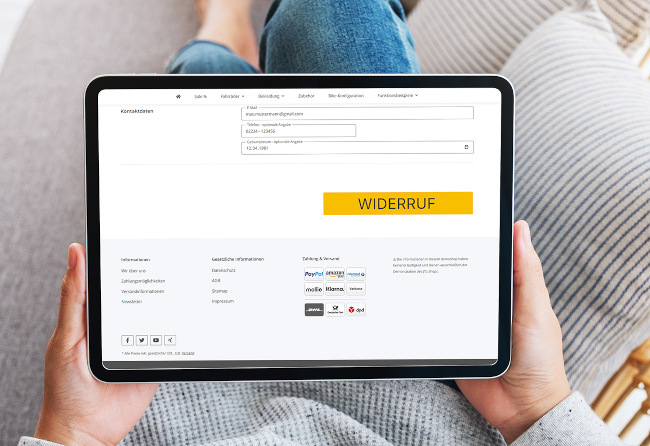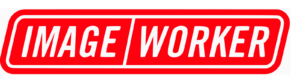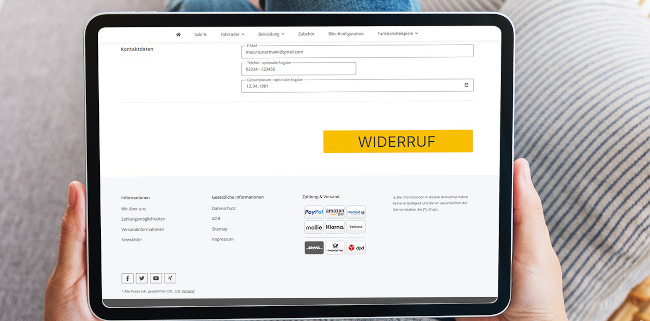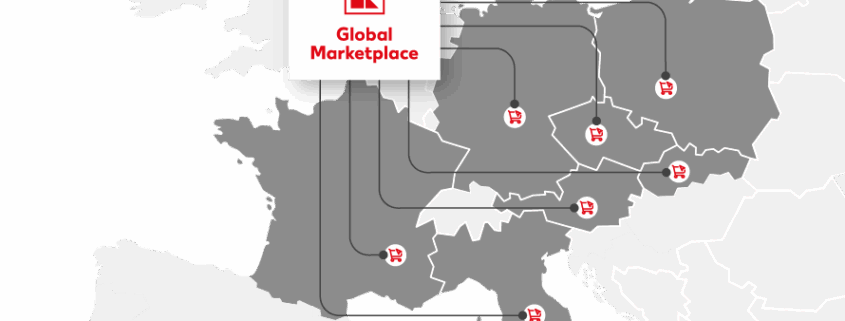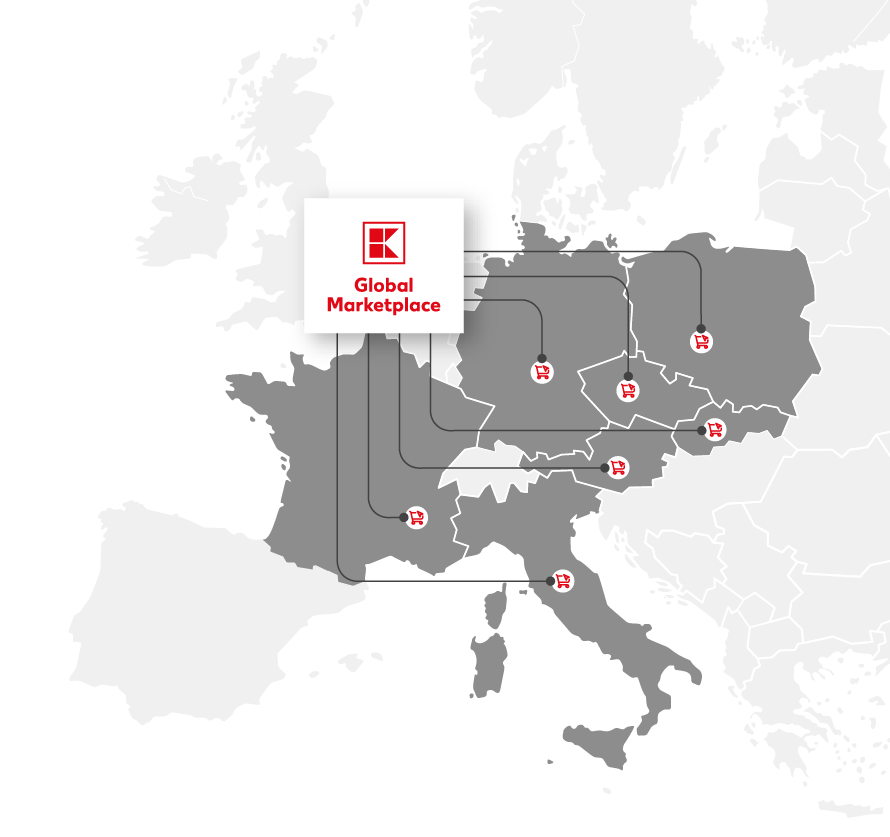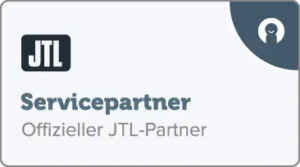Ob kleiner Shop oder großer Versandhändler, eines brauchen alle, um im E-Commerce erfolgreich zu sein: einen Überblick über Lagerbewegungen und Bestände. Eine zentrale Kennzahl dabei ist die Umschlagshäufigkeit. Sie verrät, wie oft sich der Lagerbestand in einem Zeitraum vollständig dreht, also wie oft der komplette Bestand verkauft und wieder aufgefüllt wird.
Ein hoher Lagerumschlag im Onlinehandel ist meist ein Zeichen für effiziente Prozesse. Eine niedrige Umschlagshäufigkeit kann auf Kapitalbindung, veraltete Ware oder falsche Einkaufsentscheidungen hindeuten. Allerdings spielen bei der Interpretation mehrere Faktoren eine Rolle.
In diesem Beitrag erklären wir Euch:
- wie Ihr die Umschlagshäufigkeit berechnet
- welche Rolle Lagerkennzahlen wie Wareneinsatz und Lagerbestand dabei spielen und
- wie Ihr mit den richtigen Maßnahmen für mehr Effizienz im Lager sorgt.
Wie könnt Ihr die Umschlagshäufigkeit berechnen? – Formel mit Erklärung
Die Umschlagshäufigkeit beziehungsweise Lagerumschlagshäufigkeit lässt sich mit einer einfachen Formel berechnen:
Umschlagshäufigkeit = Wareneinsatz / durchschnittlicher Lagerbestand
Der Wareneinsatz ist der Warenverbrauch, also der Wert aller Waren, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden. Den Wareneinsatz berechnen könnt Ihr folgendermaßen:
Wareneinsatz = Anfangsbestand + Zugänge – Endbestand
Alternativ wird der Wareneinsatz direkt aus der Buchhaltung entnommen, etwa als Jahreswert der verkauften Waren.
Der durchschnittliche Lagerbestand zeigt, wie viel Ware im Schnitt auf Lager war. Ihr könnt ihn mit einer einfachen Faustformel ermitteln:
(Anfangsbestand + Endbestand) / 2
Tipp: Für genauere Auswertungen, vor allem bei stark schwankenden Beständen, empfehlen wir eine Berechnung auf Monatsbasis.
Kurz erklärt:
Die Umschlagshäufigkeit ist eine Lagerkennzahl, die angibt, wie oft sich der durchschnittliche Lagerbestand in einem Zeitraum vollständig verkauft. Sie wird berechnet als Wareneinsatz geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand.
Wie funktioniert die Berechnung der Umschlagshäufigkeit in der Praxis? – Ein Beispiel
Ein Onlinehändler möchte wissen, wie oft sich sein Lagerbestand im Jahr 2024 „gedreht“ hat. Als Basis dienen ihm folgende Zahlen aus seiner Buchhaltung und Warenwirtschaft:
- Wareneinsatz 2024: 120.000 Euro
- Anfangsbestand: 20.000 Euro
- Endbestand: 40.000 Euro
Zuerst berechnet er den durchschnittlichen Lagerbestand:
(20.000 Euro + 40.000 Euro) / 2 = 30.000 €
Anschließend setzt er die Werte in die Formel zur Umschlagshäufigkeit ein:
120.000 Euro / 30.000 Euro = 4
Der Lagerbestand hat sich im Jahr 2024 viermal komplett umgeschlagen. Je nach Branche und Produkttyp ist dies ein solider Wert oder verbesserungswürdig. Wie sich die Kennzahl interpretieren lässt und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen, erklären wir im nächsten Abschnitt.

Was bedeutet eine hohe oder niedrige Umschlagshäufigkeit?
Die Umschlagshäufigkeit ist eine zentrale Lagerkennzahl zur Bewertung der Lagerleistung. Sie liefert wichtige Hinweise auf die Effizienz der Lagerhaltung und hilft, Lagerkosten, Kapitalbindung und Liquidität besser zu steuern:
- Eine hohe Lagerumschlagshäufigkeit ist in der Regel ein gutes Zeichen:
Sie bedeutet, dass Waren schnell durchlaufen, wenig Zeit im Lager verbringen und rasch verkauft werden. Das minimiert Lagerkosten und reduziert das Risiko von Verderb oder Wertverlust (etwa bei saisonaler Ware). Außerdem verbessert eine hohe Umschlagshäufigkeit die Kapitalnutzung, weil gebundenes Kapital schnell in Umsatz verwandelt wird. Auch die Gefahr von Abschreibungen oder veralteten Produkten sinkt.
- Eine niedrige Lagerumschlagshäufigkeit weist häufig auf Schwächen im Sortiment, im Einkauf oder in der Absatzplanung hin.
Bleibt Ware lange liegen, blockiert sie Lagerfläche, bindet Kapital und erhöht das Risiko von Überalterung, Schwund oder Abschreibung. Mögliche Ursachen reichen von Überbestellungen über eine zu große Sortimentsbreite bis hin zu fehlender Nachfrage oder ineffizienten Lagerprozessen.
Wichtig: Die Umschlagshäufigkeit lässt sich nicht pauschal bewerten. Denn je nach Branche, Produktart und Geschäftsmodell sind unterschiedliche Umschlagshäufigkeiten sinnvoll.
Einige Beispiele:
- Im Fast-Fashion-Bereich oder Lebensmitteleinzelhandel sind hohe Umschlagshäufigkeiten üblich, teils im wöchentlichen Rhythmus.
- Im Technikhandel, bei Möbeln oder Industriebedarf kann eine niedrigere Umschlagshäufigkeit normal sein, weil Lagerhaltung notwendig ist, um Lieferfähigkeit sicherzustellen.
- Bei hochpreisigen Produkten wie Maschinen oder Schmuck sind Umschläge seltener. Der Fokus liegt stärker auf der Marge und der Qualität der Bestände.
Daher ist es sinnvoll, die eigene Umschlagshäufigkeit regelmäßig zu analysieren – im zeitlichen Verlauf, im Vergleich mit branchentypischen Werten und bezogen auf einzelne Warengruppen oder Artikel. So könnt Ihr Verbesserungspotenziale identifizieren und gezielt strategische Entscheidungen im Einkauf oder in der Lagerlogistik treffen.
Wie könnt Ihr den Lagerumschlag im Onlinehandel verbessern? – 5 konkrete Maßnahmen
Wenn Ihr Eure Umschlagshäufigkeit steigern wollt, bieten sich mehrere Stellschrauben an, vom Einkauf über das Sortiment bis zur Lagerorganisation. Die folgenden Maßnahmen helfen Euch, den Warenfluss zu optimieren und Lagerbestände schlanker zu halten:
1. Sortiment analysieren und straffen
Unrentable oder langsam drehende Artikel blockieren Lagerfläche und Kapital. Ein regelmäßiger Blick auf die Lagerkennzahlen, etwa mithilfe der ABC-Analyse, hilft, das Sortiment kritisch zu überprüfen: Welche Artikel verkaufen sich gut? Welche bleiben liegen? Weniger ist oft mehr, vor allem, wenn dadurch schnell drehende Produkte mehr Platz erhalten.
Die ABC-Analyse ist ein betriebswirtschaftliches Verfahren, um Produkte nach ihrem Wert oder ihrer Bedeutung für ein Unternehmen zu klassifizieren, etwa nach Umsatz, Verkaufsmenge oder Lagerumschlag.
- A-Produkte machen meist einen hohen Anteil am Umsatz aus (z.B. 70–80 %), obwohl sie nur einen kleinen Teil der Artikelanzahl darstellen (z.B. 10–20 %). Sie sind besonders wichtig und sollten eng überwacht werden.
- B-Produkte liegen im Mittelfeld. Sie haben eine mittlere Bedeutung und sollten regelmäßig analysiert werden.
- C-Produkte machen nur einen geringen Anteil am Umsatz aus, beanspruchen aber oft viel Lagerplatz. Sie eignen sich gut für eine Sortimentsbereinigung oder Sonderaktionen.
Mit der ABC-Analyse lassen sich Lagerbestände gezielt optimieren, z.B. durch bessere Priorisierung im Einkauf, bei der Platzvergabe oder in der Verkaufsförderung.
2. Einkaufsplanung verbessern
Zu große Bestellmengen auf Verdacht führen schnell zu übervollen Lagern. Wenn Ihr Einkaufsentscheidungen auf Basis realer Verkaufsdaten trefft, idealerweise unterstützt durch ein Warenwirtschaftssystem, könnt Ihr genauer kalkulieren und die Lagerreichweite optimieren. Berücksichtigt dabei auch saisonale Schwankungen und Trends.
3. Verkaufsaktionen gezielt einsetzen
Langsam drehende Artikel lassen sich oft durch gezielte Rabattaktionen, Bundles oder Cross-Selling-Maßnahmen schneller abverkaufen. Gleichzeitig kann der Abverkauf genutzt werden, um Platz für neue Produkte zu schaffen und so den Lagerumschlag insgesamt zu beschleunigen.
4. Lieferzeiten und Mindestbestände optimieren
Je schneller neue Ware nachbestellt und geliefert werden kann, desto geringer muss der Lagerbestand gehalten werden. Durch flexible Lieferketten, optimierte Mindestbestände und automatische Bestellvorschläge lassen sich Bestände besser steuern, ohne die Lieferfähigkeit zu gefährden.
5. Lagerorganisation verbessern
Ein gut strukturiertes Lager erleichtert nicht nur die Kommissionierung, sondern auch die Kontrolle über Warenbewegungen. Wenn Ihr Artikel nach Umschlagshäufigkeit lagert (zum Beispiel Schnellläufer nah an den Packplätzen), spart Ihr Zeit und erkennt schneller, wo sich Bestände unnötig stauen.

Wie Euch JTL-Wawi und JTL-WMS bei der Analyse und Optimierung der Umschlagshäufigkeit unterstützen
Um die Umschlagshäufigkeit nicht nur zu berechnen, sondern auch dauerhaft zu verbessern, braucht Ihr mehr als Excel-Tabellen. Mit den richtigen digitalen Werkzeugen lassen sich Lagerkennzahlen automatisiert erfassen, auswerten und strategisch nutzen.
JTL-Wawi und JTL-WMS sind die perfekten Werkzeuge dafür:
JTL-Wawi
Als zentrale Warenwirtschaft bietet Euch JTL-Wawi eine umfassende Datenbasis für alle relevanten Lagerkennzahlen. Ihr könnt den Wareneinsatz, den durchschnittlichen Lagerbestand und viele weitere Größen direkt im System einsehen, ganz ohne manuelle Berechnungen.
Über integrierte Statistiken und Artikelanalysen lassen sich Produkte nach Verkaufsverhalten, Lagerdauer oder Umsatzstärke bewerten. So ist sofort sichtbar, welche Artikel gut laufen und welche den Lagerumschlag ausbremsen.
Darüber hinaus unterstützt Euch JTL-Wawi aktiv bei der Optimierung:
- Bestellvorschläge auf Basis tatsächlicher Verkaufszahlen helfen, Mengen passgenau zu planen.
- Mindestbestandswarnungen verhindern Out-of-Stock-Situationen, ohne Lager zu überfüllen.
- Durch die Integration mit anderen JTL-Komponenten (z.B. JTL-eazyAuction, JTL-Shop) fließen alle Vertriebsdaten zentral zusammen. Das schafft eine einheitliche Entscheidungsgrundlage.
JTL-WMS
Als Lagerverwaltungssystem liefert Euch JTL-WMS Echtzeitdaten zu Warenbewegungen und Lagerzuständen. Artikel mit hoher Umschlagshäufigkeit können gezielt in schnell zugänglichen Lagerzonen platziert werden, um Kommissionierwege zu verkürzen und Prozesse effizienter zu gestalten. Gleichzeitig lassen sich Bewegungsdaten nutzen, um Lagerstrategien dynamisch anzupassen – etwa bei saisonalen Schwankungen oder Änderungen im Nachfrageverhalten.
Das Zusammenspiel von JTL-Wawi und JTL-WMS ermöglicht es Euch als Onlinehändler, Lagerkennzahlen zu überwachen und aktiv zur Steuerung und Optimierung einzusetzen. So wird aus einer theoretischen Kennzahl wie der Lagerumschlaghäufigkeit ein echter Hebel für mehr Effizienz, Liquidität und Kundenzufriedenheit.
Fazit: Warum sich der Blick auf die Umschlagshäufigkeit lohnt
Die Umschlagshäufigkeit ist weit mehr als nur eine Zahl. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz im Lager und die Qualität eines Sortiments. Wenn Ihr sie regelmäßig analysiert, erkennt Ihr früh, wo Kapital gebunden ist, welche Produkte Potenzial haben und wo Prozesse optimiert werden können. Mit der richtigen Datengrundlage und digitalen Unterstützung durch Tools wie JTL-Wawi und JTL-WMS wird aus einer theoretischen Kennzahl ein praxisnahes Steuerungsinstrument. Ihr könnt Lagerkosten senken, die Lieferfähigkeit sichern und Euer Geschäft gezielt weiterentwickeln.